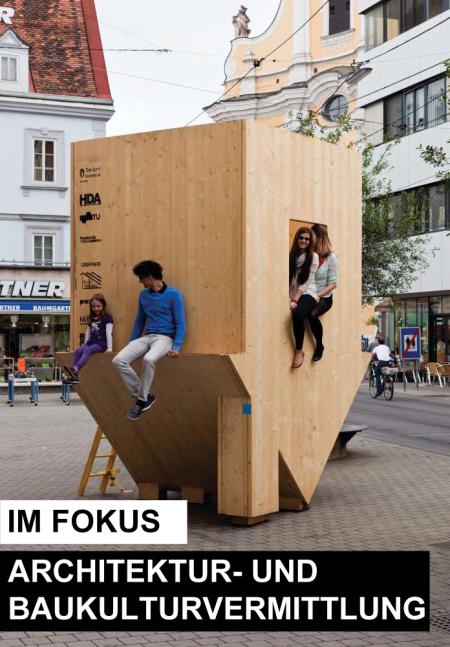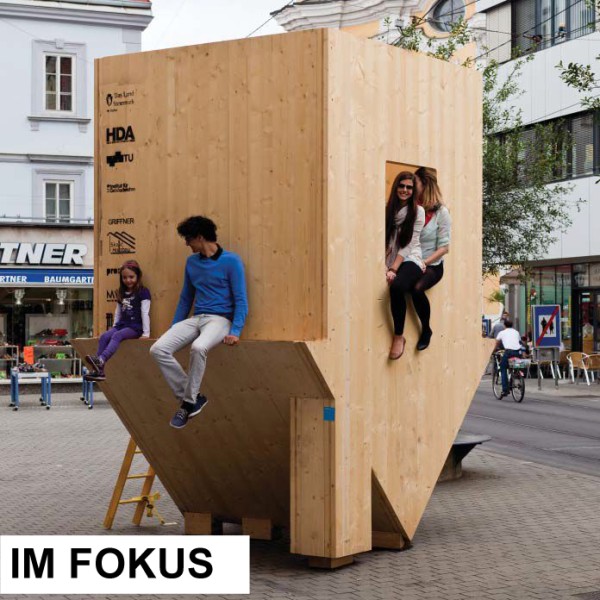Kompetenzorientierung
Ilse Schrittesser hat seit März 2014 die Professur für Schulforschung und LehrerInnenbildung am Zentrum für LehrerInnenbildung und der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft (Universität Wien) inne. Forschungsschwerpunkte: Schulforschung mit besonderer Berücksichtigung der Lehr- und Lernforschung, Professionalisierungsforschung und Forschung zur LehrerInnenbildung.
Den veröffentlichten Text hielt sie als Vortrag am 24.9.2013 bei der IMST-Tagung in Klagenfurt.
Der Begriff der Kompetenz hat gegenwärtig Hochkonjunktur. Sowohl in der PädagogInnenbildung als auch im Unterricht soll es vorrangig darum gehen, Kompetenzen zu vermitteln. Beleuchtet man den Begriff und seine Geschichte näher, so lässt sich herausarbeiten, welche Bedeutungen mit „Kompetenz“ aus Sicht der pädagogischen Lern- und Unterrichtsforschung transportiert und welche Bereiche möglicherweise in der gegenwärtigen Begriffsverwendung ausgeblendet werden.
Heinrich Roth etwa spricht im zweiten Band seiner Schrift zur „Pädagogischen Anthropologie“ (1971) von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als grundlegende menschliche Fähigkeiten und verbindet diese mit der Idee der Mündigkeit und damit mit einem emanzipatorischen Anspruch. Ist dieser Anspruch in der heute weit verbreiteten Rede von Kompetenzorientierung, die meist an eine Begriffsbestimmung von Franz E. Weinert (2001) anschließt, noch auffindbar? Weinert bestimmt Kompetenz als die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können. (Weinert 2000, S. 27f.)
Geht es vorrangig um Problemlösefähigkeiten, wenn sich Unterricht an Kompetenzvermittlung orientiert und auf konkret erfassbare Lernergebnisse abzielt, und ist damit der Anspruch auf Bildung erfüllt? Kompetenzerwerb, so lautet meine These, ist zwar die Grundstufe für gelingende Bildungsprozesse, Bildungsprozesse gehen jedoch über Kompetenzerwerb hinaus.
Kompetenzorientierter Unterricht ist nur dann auch Bildung fördernder Unterricht – und letzteres ist Ziel jeden Unterrichts –, wenn man bei den Kompetenzen und den damit aktuell verbundenen diversen Testungen nicht hängen bleibt („teaching to the test“) und das übergeordnete Bildungsziel des Fachs nicht aus den Augen verliert.
Ich habe mich bereits in einem früheren Artikel (Schrittesser 2011) mit der Frage der Kompetenzorientierung beschäftigt. Was mir im Laufe dieser Beschäftigung deutlich wurde, ist die Problematik des Kompetenzbegriffs selbst, der recht unterschiedliche Bestimmungen erfährt, der aber auch eine recht eindrucksvolle Begriffsgeschichte aufweist. Ich werde mich daher zunächst dieser Begriffsgeschichte zuwenden. Anschließend werde ich mich mit der Frage befassen, ob und wie sich die gegenwärtige Rede von Kompetenzorientierung mit neueren Erkenntnissen der Lernforschung vereinbaren lässt. Abschließend möchte ich einige Konsequenzen aus den zuvor angestellten Überlegungen für so genannten kompetenzorientierten Unterricht zu ziehen versuchen.
Ein Blick auf den Kompetenzbegriff
Die erste Hochkonjunktur erfährt der Kompetenzbegriff im Anschluss an Heinrich Roth, der im zweiten Band seiner Schrift zur „Pädagogischen Anthropologie“ (1971) von Sach-, Selbst und Sozialkompetenz als grundlegenden menschlichen Fähigkeiten spricht. Roth verbindet diese mit der Befähigung zur Mündigkeit.
Mündigkeit, schreibt Roth, wie sie von uns verstanden wird, ist als Kompetenz zu interpretieren, und zwar in einem dreifachen Sinne: a) als Selbstkompetenz (selfcompetence), d.h. als Fähigkeit, für sich selbstverantwortlich handeln zu können, b) als Sachkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können, und c) als Sozialkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können. (Roth 1971, S. 180) Adorno bringt es griffig auf den Punkt: Mündig ist der, der für sich selbst spricht, weil er für sich selbst gedacht hat und nicht bloß nachredet […]. (Adorno 1997, S. 785)
Dieses Verständnis von Kompetenz wird in der Folge vor allem in der beruflichen Bildung rezipiert, findet aber auch in anderen Bildungsbereichen Resonanz. Die Begriffsbestimmung, die allerdings den neueren Kompetenzdiskurs bei weitem dominiert ist jüngeren Datums und stammt von Franz E. Weinert (2001, S. 27f.). Von ihm wird Kompetenz folgendermaßen zu bestimmen versucht: ... die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.
Weinerts (psychologisch fundiertes) Kompetenzmodell betont eine personal orientierte Dimension: in der Perspektive erster Person geht es um Dispositionen und Bereitschaften des Individuums, um die sich kognitive Fähigkeiten gruppieren und diese im Vollzug von Problemlösungen zur Entfaltung bringen. Ein Schlüsselmerkmal dieses Kompetenzbegriffs sei, so Klieme & Hartig (2007) in einer ausführlichen Analyse, der stärkere Bezug zum "wirklichen Leben". (Klieme & Hartig 2007, S. 17) Kompetenz ist in diesem Sinne als lebenspraktisch ausgerichtete Leistung des Subjekts zu verstehen, die es erbringt, um Situationen unterschiedlicher Komplexität und Schwierigkeitsgrade zu bewältigen.
In einem anderen Begriffsverständnis wiederum, vor allem in den die aktuellen Bildungsreformen begleitenden diversen Strategie- und Grundlagenpapieren, wird der Kompetenzbegriff in weiteren Variationen beschrieben. So ist etwa einer Unterlage aus dem österreichischen Bundesministerium für Bildung und Frauen im Anschluss an den Europäischen Qualifikationsrahmen zu entnehmen, dass man Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz unterscheiden müsse, dass also nicht Kenntnisse und Fertigkeiten Aspekte von Kompetenz seien, sondern es sich bei Kenntnissen um Theorie- und Faktenwissen handle, bei Fertigkeiten um kognitive Fertigkeiten, die zur Nutzung relevanter Informationen erforderlich sind, um Aufgaben auszuführen und Routineprobleme unter Verwendung einfacher Regeln und Werkzeuge zu lösen. (KU-Grundlagenpapier 2012, S. 8) Kompetenz, schließlich, sei vor diesem Hintergrund im Sinne der Übernahme von Verantwortung und Selbständigkeit, man könnte also sagen im Sinne eines Sich-Zuständig-Fühlens zu verstehen. (ebda.) Dass Verantwortung und Kompetenz in Beziehung zu setzen sind, lässt sich auch aus dem Weinert’schen Kompetenzbegriff herauslesen, hier jedoch bezogen auf Problemlösungen, deren Umsetzung verantwortungsvoll zu erfolgen habe – Verantwortung wofür wird allerdings nicht näher ausgeführt. Ebenso ist der Aspekt der Selbständigkeit immer wieder in Kompetenzbestimmungsversuchen zu finden: wer kompetent ist, so der Tenor, kann Probleme eigenständig und erfolgreich einer Lösung zuführen.
Kompetenzorientierung im Schulunterricht
Diese kurzen Erläuterungen sollen zeigen, dass der Kompetenzbegriff ein recht schillerndes Bedeutungsspektrum aufweist und sich einer eindeutigen, allgemein gültigen Bestimmung entzieht. Daher wird auch der Frage der Kompetenzorientierung im Schulunterricht zunächst die Frage vorausgehen müssen, was denn unter Kompetenz nun schlussendlich vor dem Hintergrund des Bildungsauftrags des jeweiligen Schulfaches zu verstehen ist – auch um etwas Ordnung in die unübersichtliche und teilweise auch widersprüchliche Begriffslandschaft zu bringen. Der Begriff der Kompetenz stellt sich vor diesem Hintergrund als ein hypothetisches Konstrukt dar, das eingebettet ist in ein Spannungsgefüge von Problemlösefähigkeit (ein sich stellendes Problem erfolgreich lösen können) und Mündigkeit (als selbständiges Handeln und als eigenständige und ebenso widerständige Urteilsfähigkeit in sachlichen und sozialen Belangen).
In einem ersten Resümee lässt sich feststellen, dass man im Grunde nicht nicht kompetenzorientiert unterrichten kann. Kompetenzen werden immer vermittelt. Wir kennen dieses Argument aus der Diskussion um den heimlichen Lehrplan (vgl. etwa Bernfeld 1925; Zinnecker 1975; Dreeben 1998). Die Frage ist jedoch, ob Schülerinnen und Schüler die intendierten Kompetenzen erwerben oder ob sie sich bloß zufällig und beiläufig Kompetenzen aneignen (z.B. „Stoff“ so zu reproduzieren, wie ihn die Lehrerin bzw. der Lehrer hören will oder jene Lernergebnisse zu erzielen, wie sie in diversen „large-scale“ Assessments abgefragt werden).
Deutlich wird jedoch auch, betrachtet man die hier kurz skizzierte Begriffslandschaft, dass wir es mit einer nicht unerheblichen Akzentverschiebung zu tun haben. Kompetenz in diesem aktuellen Verständnis meint nämlich auch, dass man etwas nicht nur können muss, man muss es auch zeigen können und wollen. Kompetenzen werden somit erst dann als solche wahr- und ernst genommen, wenn sie durch Handeln sichtbar und – noch wichtiger – überprüfbar gemacht werden. Das wiederum bedeutet, dass komplexe Verstehens- und Lernprozesse in operationalisierbare Einheiten überführt werden müssen, um sie einer Überprüfung unterziehen zu können – sofern man unter Überprüfung einen Testvorgang versteht, wie wir ihn etwa im Rahmen der groß angelegten Schulleistungstests kennen gelernt haben.
Wie aber verhält sich dieser deutliche Trend, der vor allem in den jüngeren bildungspolitischen Ereignissen rund um PISA & Co spürbar ist, zu neueren Erkenntnissen der (pädagogischen) Lernforschung? Ich betone „pädagogische“ Lernforschung deshalb, weil der Lernbegriff als einheimischer Begriff der Pädagogik erst kürzlich wieder entdeckt wurde, nachdem die Lernforschung über lange Zeit hinweg der Psychologie, der pädagogischen Psychologie und der Kognitionswissenschaft (neuerdings auch den Neurowissenschaften) überlassen wurde. Erst in den letzten etwa zehn Jahren begann die Forschung in Pädagogik und Bildungswissenschaft wieder aus ihrer spezifischen disziplinären Perspektive Erkenntnisse zu Lernen zu erarbeiten und erste Ergebnisse vorzulegen – ich werde später auf diese Perspektive zurückkommen. Zunächst nur so viel: die pädagogische Perspektive wirft ihr Licht nicht nur auf den Lernenden bzw. die Lernende in experimentellen Settings, sondern denkt die Sache und das Lehren in Bezug zu den Lernenden unter realen (und damit auch komplexen, teilweise daher auch unübersichtlichen) Bedingungen mit. Für den pädagogischen Blick ist Lernen dann von besonderem Interesse, wenn es um das Erlernen von etwas – meist unter Anleitung – geht und das Ziel verfolgt wird, weitere, darauf aufbauende Lernprozesse anzuregen. Lernen zu verstehen heißt aus pädagogischer Sicht immer, ein Verhältnis zwischen Lernendem und Welt als Möglichkeit der Weiterentwicklung dieses Verhältnisses zu begreifen. (Göhlich et al. 2007, S. 7, vgl. auch Göhlich & Zirfas 2007)
Um eine kurze Darstellung dieser Entwicklung zu skizzieren, werde ich vier Zugänge näher betrachten, die für diese pädagogische Perspektive aktuell von Bedeutung sind und zur Diskussion stehen. Dazu gehören Jean Piagets Zugang zur Frage nach der Entfaltung von Erkenntnis (1), der Ansatz der so genannten Learning Sciences (2), Klaus Holzkamps Suche nach den Lerngründen (3) und schließlich Lerntheorien, die sich auf phänomenologische Denkansätze berufen.
1. Jean Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung des Menschen stellt ein schillerndes Referenzmodell dar. Nahezu alle aktuell prominenten psychologischen und kognitionswissenschaftlichen Lerntheorien nehmen Bezug auf seinen Ansatz. Die kognitive Entwicklung, so lautet Piagets zentrale These, basiere auf allgemeinen, dynamischen Handlungsstrukturen – Schemata –, die sich in der Interaktion des Kindes mit der Welt fortschreitend aufbauen. Diese Schemata entständen durch ein stetes Zusammenspiel von Einpassung (Assimilation) der Eindrücke in vorhandene Schemata und Anpassung (Akkomodation) der Schemata an die Eindrücke der Welt. Die beiden Vorgänge führten schließlich im Streben nach Gleichgewicht zu einem Zuwachs an Erkenntnis. (Piaget 1970/2003, S. 61f.) Der Erkenntniszuwachs erfolge in Entwicklungsstufen – vom vorbegrifflichen über das anschauliche, das konkret-operatorische bis hin zum formal-abstrakten, hypothetisch-deduktiven Denken.
Lt. Piaget regen demnach dosierte Diskrepanzerlebnisse fruchtbare Momente des Lernens an, die Neues anbieten, jedoch nicht so weit von den vorhandenen Schemata abweichen, dass dieses Neue nicht mehr wahrgenommen und in der Folge auch nicht aufgenommen werden kann.
2. Die relativ neue Forschungsrichtung der „Learning Sciences“ beruft sich auf Piagets genetischen Strukturalismus bei der Konzeption ihres Lernbegriffs. Die Learning Sciences begreifen sich als neue, interdisziplinär ausgerichtete Wissenschaftsrichtung, die – neben Piagets Erkenntnistheorie – auf Erkenntnisse sowie Methoden unterschiedlicher Disziplinen, wie Kognitionswissenschaft, Psychologie, Computerwissenschaften, Neurowissenschaften, Philosophie, Soziologie, Anthropologie und Erziehungswissenschaft, zurückgreifen und in einen interdisziplinären Diskurs zu bringen versuchen. Die interdisziplinäre Ausrichtung soll der Garant dafür sein, neue Erkenntnisse über menschliches Lernen zu liefern (vgl. Sawyer 2006). Vertreter der Learning Sciences sind aktuell übrigens auch Referenzautorinnen und -autoren für OECD-Initiativen (vgl. z.B. Sawyer 2008). Ein Grund dafür ist wohl nicht nur der Versuch einer innovativen Perspektive auf das Phänomen des Lernens, sondern auch die Ausrichtung der Learning Sciences am gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen ihrer Forschung, deren erklärtes Ziel es ist, vor allem Wege der Effizienzsteigerung von Lernprozessen zu finden – ein Fokus, der von Vertreterinnen und Vertretern genuin pädagogischer Lerntheorien kritisch gesehen wird (vgl. dazu z.B. Rumpf 2008).
Sawyer fasst die wesentlichen Erkenntnisse der gemeinsamen Forschungsanstrengungen wie folgt zusammen: Lernen aus Sicht der „Learning Sciences“ wird dann gefördert, wenn das Vorwissen als Einstieg in ein Thema aktiviert wird („building on prior knowledge“), wenn lautes Denken und Reflexion („metacognition, reflection“) im Lernsetting reichlich Platz gegeben wird (z.B. durch kollaborative Designs und Peer Learning Phasen) und wenn strukturierte Anleitung, Denkanstöße, Lernhilfen („scaffolding“) geboten werden (Sawyer 2008, S. 52ff.). Was die Learning Sciences in die Nähe pädagogischer Lernforschung bringt, ist ihr Interesse an der authentischen Lernsituation etwa im Unterricht, im Gegensatz zum Mainstream der psychologischen und kognitionswissenschaftlichen Lernforschung, die Lernprozesse eher in Laborsettings untersucht. Divergenz zu pädagogischen Ansätzen wird, wie schon oben angemerkt, vor allem dort zu identifizieren sein, wo dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen optimal strukturierter Lernumgebungen und damit deren größtmögliche Effizienz der Vorrang vor dem Eigenrecht der Lernenden gegeben wird. Ebenso bedarf der wissenschaftstheoretische Standpunkt der Learning Sciences einer weiteren Klärung, und zwar vor dem Hintergrund des interdisziplinär geführten, noch um eine eigene, die verschiedenen Gesichtspunkte zusammenführende Sprache ringenden Diskurses.
3. Ein weiterer lerntheoretisch bedeutender Ansatz, der in letzter Zeit vor allem im pädagogischen Diskurs wieder an Bedeutung gewinnt, geht auf Klaus Holzkamp zurück. Holzkamp bestimmt Lernen aus subjektwissenschaftlicher Sicht als „aktive Selbstveränderung“ und nennt seinen Zugang „Lernen im Begründungsdiskurs“ (vgl. Holzkamp 1995). Ihm geht es darum, statt der Untersuchung zu Bedingungen des Lernens, wie sie in der psychologischen und kognitionswissenschaftlichen Forschung betrieben wird, den Blick auf die subjektiven Lerngründe zu werfen, die jedem Lernen vorausgehen bzw. dieses begleiten. Lernanlässe ergeben sich gemäß diesem Ansatz immer dann, wenn man mit direkter Problembewältigung bzw. Problemlösung nicht weiter kommt, wenn man innehält und in Distanz geht, um herauszufinden, wodurch die Schwierigkeiten entstanden sind (vgl. Holzkamp 1995, S. 184). Problemlösefähigkeit zu erwerben wäre daher in diesem Zugang maximal eine Vorstufe vertieften Lernens. Letzteres erfasst den ganzen Menschen und wird erst angeregt, wenn sich ein Lerngrund einstellt. Ein Lerngrund sei lt. Holzkamp entweder expansiv orientiert, d.h. auf die Erweiterung der subjektiven Handlungsmöglichkeiten ausgerichtet, oder defensiv motiviert mit dem Ziel der Abwehr einer Verschlechterung der Lebensbedingungen (Paradebeispiel für defensive Lerngründe wären nach Holzkamp die aktuelle Praxis der Schulnotenvergabe). Fazit: Lernen brauche Lerngründe, wenn es zu einer „aktiven Selbstveränderung“ – dem Ziel allen Lernens – kommen soll.
4. Werfen wir noch einen Blick auf einen weiteren aktuell breit diskutierten Ansatz: Lernen in pädagogischer Perspektive (vgl. u.a. Meyer-Drawe 2003 und 2008, Göhlich, Wulf & Zirfas 2007, Mitgutsch et al. 2008). Käte Meyer-Drawe, eine der prononciertesten VertreterInnen dieses Ansatzes bestimmt Lernen als Erfahrung (im Gegensatz zu Lernen durch Erfahrung): Lernen ist in pädagogischer Perspektive und in strengem Sinne eine Erfahrung (Meyer-Drawe 2008, S. 15). Weniger das Ergebnis als der Prozess bzw. der Vollzug des Lernens wird unter die Lupe genommen. Vor allem die Anfänge des Lernens stehen im Zentrum des Interesses dieser Lerntheorie. Der Vollzug würde sich zwar sowohl den Lernenden als auch den das Lernen Erforschenden entziehen, wo er sich aber andeutet, sei ihm Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Meyer-Drawe 2008, S. 192). So sei etwa der Irritation, die häufig als zeitraubendes Phänomen erlebt wird, die aber Lernprozesse überhaupt erst auslöst, in einer pädagogischen Lerntheorie besondere Aufmerksamkeit zu schenken. (Meyer-Drawe 2008, S. 15)
Unstimmigkeit, Irritation, Ausweglosigkeit, Staunen, Wundern, Stutzen, Ratlosigkeit, Verwirrung und Benommenheit unterbrechen den Fluss des Selbstverständlichen und drängen auf Verständnis. (Meyer-Drawe 2008, S. 202) Lernen als Erfahrung werde durch einen Moment der Krise, der Irritation, des Staunens ausgelöst. Für den Unterricht hieße das – folgen wir diesbezüglichen Überlegungen von Horst Rumpf (2008) –, dass man zwischen Lernen als Erledigung und Lernen als Vollzug unterscheiden müsse. Lernen als Erledigung habe das Ziel den Reibungswiderstand durch die Herausforderung des Neuen und Unbekannten zu minimieren. Demgegenüber lässt sich Lernen als Vollzug ein auf die Unbekanntheiten, die Unstimmigkeiten, die auch bedrohlichen Offenheiten – es nimmt Risiken des Probierens auf eigene Faust hin und vertraut nicht der Autorität, die Instrumente zum Zeitgewinn und zur Wegabkürzung bereit hält. Es nimmt Umwege und auch Abstürze in Kauf. (Rumpf 2008, S. 23) Im englischsprachigen Diskurs der „Learning Sciences“ spricht man analog dazu von „deep learning“ im Vergleich zu „surface learning.“ (vgl. u.a. Hattie 2003; Sawyer 2006). „Surface learning“ wird allerdings, im Gegensatz zu Rumpfs Verständnis, durchaus als eine sinnvolle, da „brauchbare“ Dimension bestimmt – nämlich als jene Formen von Lernen, die sich auf Wissen um Inhalte beziehen und auf die Lösung von Alltags- und Routineprobleme abzielen. „Deep learning“ hingegen habe mit dem Suchen nach Zusammenhängen, nach Kontextualisierungen und mit der Fähigkeit zur Abstraktion und zur Innovation zu tun.
Abschließend möchte ich statt etwaige Differenzen in den Blick zu nehmen, die Schnittpunkte herausarbeiten, die sich aus pädagogischer Sicht in der Zusammenschau aktueller Erkenntnisse über gelingende Lernprozesse ergänzen, um aufzuzeigen, wieviel mehr Facetten zu beachten sind als ein bloßes Abstellen auf die Messung von Lernergebnissen, wie es sich durch ein reduziertes Verständnis von Kompetenzorientierung aufdrängen könnte:
Zunächst ist die Bedeutung des Vorwissens bzw. der Vorerfahrung, die Lernende mitbringen, anzuerkennen und als wesentliches Moment im Lernprozess zu würdigen. Mitgebrachtes Wissen und vorhandene Erfahrungen – auch wenn es sich um Missverständnisse handelt – sichtbar und erlebbar zu machen, ist als bedeutsame Anregung von sinnhaltigen Lernprozessen zu nennen. Eine strukturierte Begleitung des Lernens („scaffolding“ im Begriff der Learning Sciences) ist dabei ebenso relevant wie das Ermöglichen von zunehmend eigenständiger Erkundung. Auch wäre zu beachten, dass dosierte Diskrepanzerlebnisse (in Piagets Begrifflichkeit), lernanregende Wirkung haben. Die Anfänge des Lernens (den „fruchtbaren Moment“) im Blick zu halten und z.B. Fragen der Lernenden proaktiv aufzugreifen und in diesem Zusammenhang Fehlern als konstitutive Momente im Lernprozess verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken, ist ein weiterer für fruchtbare Momente im Lernprozess sorgender Aspekt.
Schließlich gälte es, Lerngründe anzubieten, um subjektiv motiviertes Lernen zu fördern. Ebenso wären die reflexiven und evaluativen Momente des Lernprozesses zur Geltung zu bringen (z.B. durch begleitende Selbstevaluierung und Beratung), um Bildungsprozesse (als „aktive Selbstveränderung“) zu initiieren.
Die Frage nach dem Lernen als Prozess und als Erfahrung ist demnach ausgerichtet am Erwerb von Erkenntnis und Verstehen, aufbauend auf Vorwissen und Vorerfahrung, daran, (expansive) Lerngründe zu initiieren, Interesse und Neugier zu wecken und reflexive Momente und Momente des Innehaltens zu fördern.
Alles Lernen kann zur Eröffnung einer Bildungserfahrung im Horizont eines gelingenden Lebens werden – muss dies aber nicht.
Die gegenwärtig im Vordergrund stehende Bedeutung von Lernergebnissen vor dem Hintergrund der breit angelegten Kompetenzmessungen – Lernergebnisse und damit erworbene Kompetenzen (im Sinne von Problemlösungsfähigkeiten) von Zeit zu Zeit zu erfassen – ist durchaus relevant, keine Frage. Jedoch habe ich zu zeigen versucht, dass der Fokus auf Lernergebnisse nur eine von vielen Facetten des Lernens darstellt. Ihre aktuelle Sonderstellung im Diskurs um Lernerfolge birgt die Gefahr, dass alle anderen maßgeblichen, das Lernen fördernde Facetten aus dem Blick geraten. Diese Verschiebung von Relevanzen, die im Grunde gegen die neueren Erkenntnisse der Lernforschung vorgenommen wird bzw. in einer holzschnittartig vereinfachten Rezeption von Lernforschung besteht – zeigt sich an der Art und Weise, wie Anleitung zur Planung von kompetenzorientierten Curricula und kompetenzorientiertem Unterricht gegeben wird. So finden sich auf diversen Bildungsservern und Websites der Bildungssysteme der Schweiz, Deutschlands und Österreichs Vorschläge für so genannte Kompetenzraster, die die zu erlernenden Inhalte kleinteilig zerlegen und in Anwendungspakete übersetzen – man spricht, wie eingangs angemerkt, von Operationalisierung.
Dazu ein konkretes Beispiel eines solchen Kompetenzrasters aus der Kunstpädagogik auf einem Schweizer Bildungsserver (www.schule.sg.ch):
Vier Kompetenzkategorien werden angegeben: Wahrnehmung, Grundfertigkeiten, Gestaltung und Reflexion. Schon auf den ersten Blick drängt sich die Frage auf, wie zwingend und systematisch diese Einteilung ist. Oder ginge es auch anders? Zur Kategorie Wahrnehmung werden die Unterkategorien Erkennen von Materialien und Werkzeugspuren angeführt; die Grundfertigkeiten sind in die Unterkategorien Werkaufgabe bzw. Vorhaben und Werkzeugkenntnis unterteilt; Gestaltung teilt sich in Funktion und Form; Reflexion hat die (wiederum beliebig wirkenden) Unterkategorien Dokumentation und Qualitätsanspruch. Zu jeder Kategorie und ihren Teilkompetenzen werden drei Niveaustufen angegeben.
Dass diese Form der Operationalisierung vor allem der Überprüfung der Lernergebnisse dient, lässt sich an Beispielen aufzeigen, die in den jeweiligen Kategorien als Teilkompetenzen genannt werden. So heißt es etwa auf der ersten Niveaustufe zum Erkennen von Materialien, dass die Begriffe Holz, Metall, Kunststoffe, Naturmaterialien und Ton richtig zuzuordnen seien. Während diese Niveaustufe noch relativ offen formuliert ist, werden auf der nächsthöheren Stufe schon wesentlich detailliertere Vorgaben gegeben. Man müsse demgemäß, will man diese Niveaustufe positiv erreicht haben aus 10 Materialmustern 6 - 8 Werkstoffe erkennen. In der Kategorie Grundfertigkeiten mit der Unterkategorie Werkzeugkenntnis lautet die Operationalisierung, dass auf der Grundstufe die Werkzeuge und Maschinen [zu] benennen seien. Auf der zweiten Stufe geht es darum, die Werkzeuge und Maschinen richtig einsetzen und die Sicherheitsvorschriften einhalten zu können, während auf der dritten Stufe schließlich die Sicherheitsvorschriften zu begründen seien.
Das angeführte Beispiel macht den Duktus deutlich, wie Kompetenzorientierung im Unterricht bzw. dessen Planung häufig angelegt ist: vorrangig, wenn nicht ausschließlich als Grundlage für das Messen von Kompetenzen und für das Überprüfen erreichter Lernergebnisse. Eine gewisse Pragmatik bei der Bestimmung der Fertigkeiten und eine damit in Verbindung stehende Schlagseite in Richtung Erledigungslernen lässt sich bei einer solchen Zergliederung von Inhalten in messbare Einheiten kaum vermeiden, zumindest ist das Risiko groß, dass der Zug in diese Richtung abfährt.
Wird der Vollzug bzw. der Prozess des Lernens in den Vordergrund gebracht, so verlieren die genannten Operationalisierungen jedoch an Bedeutung. Dann geht es etwa darum, zu beobachten, welche Fragen die Lernenden stellen, auf welche Irrwege sie sich möglicherweise begeben und welche Fehler dabei unterlaufen, warum Interesse aufflammt oder sich Lernwiderstände zeigen, welche Motive für den Lernprozess sichtbar werden oder an welchen Stellen und warum Lerngründe wieder verloren gehen.
Kompetenzen im Sinn des eingangs diskutierten Kompetenzbegriffs stellen bei dieser näheren Betrachtung nichts anderes als komplexe Kulturtechniken dar, die eine zwar notwendige jedoch nicht hinlängliche Voraussetzung für die Entfaltung von Interesse und der Fähigkeit zu eigenständigem Umgang mit einer Aufgabe darstellen. Der Erwerb von Kompetenzen eröffnet demnach nicht schon per se die Möglichkeit einer Bildungserfahrung. Daraus folgt, dass ein ausschließlich an Kompetenzerwerb und den in diesem Zusammenhang zu messenden Lernergebnissen ausgerichteter Unterricht Gefahr läuft, die eminente Bedeutung der zieloffenen (oft auch Verirrungen und Umwege in Kauf nehmenden) Prozessbegleitung des Lernens als Kernaufgabe des Unterrichtens zu überspielen.
Wie aber kann mit der gegebenen Situation und den bildungspolitisch motivierten Vorgaben umgegangen werden?
Eine Antwort auf die Frage könnte lauten, dass die Lehrerinnen und Lehrer als Vertreter einer Profession und als Expertinnen und Experten ihres Faches aufgerufen sind, offensiv gestaltend einzugreifen. Soll die Identifizierung der erwarteten Ergebnisse auf Basis von Zielvorgaben angegeben werden, so kann man die Frage nach den Kernideen – nach den fundamentalen Ideen, dem Bildungssinn – des Faches stellen und danach fragen, welche Einsichten und welches Wissen über die Welt damit erschlossen werden soll.
Welche Fragen grundlegend bedeutsam sind und gestellt werden sollen, liegen am Grund des Unterrichtsgegenstands bzw. stellen sich im Alltag, im täglichen Umgang und im Klassengespräch, werfen ihrerseits neue Fragen auf und regen das Nachdenken an. Das Gestalten von Anwendungssituationen, die Schülerinnen und Schüler bewältigen sollen, kann dabei getrost mitgedacht werden, nur stellt dieser Aspekt nicht schon den zu erreichenden Endpunkt im Curriculum und in der Folge in der Unterrichtsplanung dar, sondern ist als eine Zwischenstation auf dem Weg zu Erkenntnis und Verstehen in und durch Unterricht (vgl. Gruschka 2009) zu denken – ein Weg, der nicht bei der Vermittlung von Kompetenzen als Handwerkszeug halt macht, sondern jede Menge bildende Erfahrungen eröffnet. Man kann Kompetenzen auch so deuten und bestimmen, dass sie über sich hinausweisen und nicht nur zur Entfaltung immer leistungsstärkerer Fähigkeiten und Fertigkeiten und zum Nachweis von Lernergebnissen, sondern auch zu jenen Bildungserfahrungen führen, die in den fundamentalen Ideen eines Gegenstandes aufgehoben sind und darauf warten, entdeckt zu werden.
Literatur:
Adorno, Th.W. (1997).Kritik. In: ders., Gesammelte Schriften. Bd 10.2. Kulturkritik und Gesellschaft II: Eingriffe/Stichworte. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 785 – 793.
Bernfeld, S. (1925). Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung, Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag; Neudruck: Frankfurt/M.: Suhrkamp 1967.
Dreeben, R. (1998). Was wir in der Schule lernen. Mit einer Einleitung von Helmut Fend. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Fritz, U.(2012). Kompetenzorientiertes Unterrichten an berufsbildenden Schulen. Grundlagenpapier. http://www.berufsbildendeschulen.at/fileadmin/content/bbs/KU/KU-Grundlag... [7.05.2014]
Göhlich, M. & Zirfas, J. (2007). Lernen. Ein pädagogischer Grundbegriff. Stuttgart: Kohlhammer.
Göhlich, M., Wulf, C. & Zirfas, J. (Hrsg.) (2007). Pädagogische Theorien des Lernens. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
Gruschka, A. (2009). Erkenntnis in und durch Unterricht. Wetzlar: Büchse der Pandora.
Hattie, J. (2003). Teachers Make a Difference. Distinguishing Expert Teachers from Novice and Experienced Teacher. http://www.acer.edu.au/documents/RC2003_Hattie_TeachersMakeADifference.pdf [ 7.05.2014] Holzkamp, K. (1995). Lernen, Frankfurt/Main und New York: Campus Verlag.
Klieme, E. & Hartig, J. (2007). Kompetenzkonzepte in den Sozialwissenschaften und im erziehungswissenschaftlichen Denken. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft 8 (2007), S. 11 – 29.
Meyer-Drawe, K. (2003). Lernen als Erfahrung. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 6. Jahrg., Heft 4/2003, S. 505 – 514.
Meyer-Drawe, K. (2008). Diskurse des Lernens. München: Wilhelm Fink.
Mitgutsch, K., Sattler, E., Westphal, K., & Breinbauer, I.M. (Hrsg.)(2008). Dem Lernen auf der Spur. Die pädagogische Perspektive. Stuttgart: Klett-Cotta.
Piaget, J. (1970/2003). Meine Theorie der geistigen Entwicklung. Weinheim: Beltz.
Piaget, J. (1999). Theorien und Methoden der modernen Erziehung. 9. Aufl. Frankfurt/Main: Fischer.
Roth , H. (1971). Pädagogische Anthropologie. Bd. 2, Hannover: Schroedel.
Rumpf, H. (2008). Lernen als Vollzug und als Erledigung. In: Mitgutsch, K., Sattler, E., Westphal, K. & Breinbauer, I.M. (Hrsg.). Dem Lernen auf der Spur. Die pädagogische Perspektive. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 21- 32.
Sawyer, K. R. (2006) (Hrsg.). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge, USA: Cambridge University Press.
Sawyer, K. R. (2008). Optimising Learning: Implications of Learning Sciences Research. In: Centre for Educational Reserach and Innovation (Hrsg.): Innovating to Learn, Learning to Innovate. Paris: OECD Publishing, S.45 – 65.
Schrittesser, I. (2011). Professionelle Kompetenzen: Systematische und empirische Annäherungen. In: Schratz et al. (2011): Pädagogische Professionalität quer denken – umdenken – neu denken. Facultas/UTB, Wien, S. 97 – 124.
Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit (2001). In: Ders., Leistungsmessung in Schulen. S. 17 – 31, Weinheim und Basel: Beltz.
Zinnecker, J. (Hrsg.) (1975). Der heimliche Lehrplan. Untersuchungen zum Schulunterricht.Weinheim und Basel: Beltz.