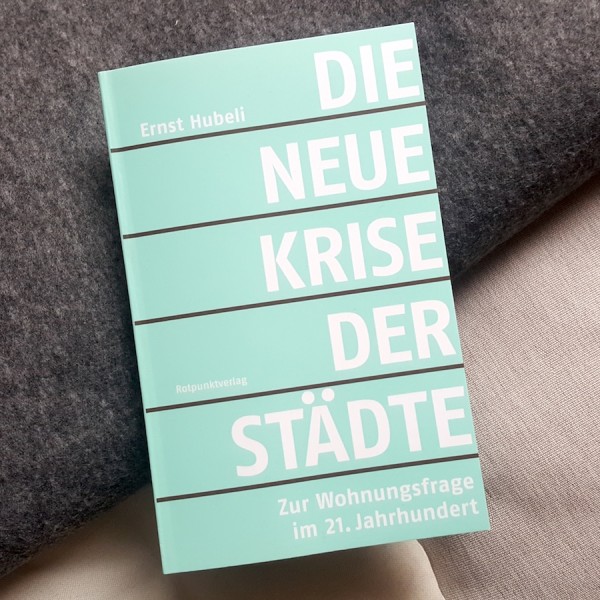Architekt Ernst Hubeli zur Grazer Stadtentwicklung und Reininghaus
BIOGRAFISCHE NOTIZ
Univ.-Prof. Arch. Ernst Hubeli war Universitätsprofessor und Leiter des Institutes für Städtebau an der TU Graz und hat ‚Asset one‘ unter der vormaligen Leitung von Roland Koppensteiner beraten. Dabei wurde eine innovative Planungsmethode für Reininghaus entwickelt. Hubeli forscht zurzeit über urbane Verdichtungs- und Zukunftsszenarien und zum Thema Stadt und Bildung. Er ist wissenschaftlicher Berater von Stiftungen und Universitäten und hat seit 1982 ein Architekturbüro in Zürich. Herczog und Hubeli haben die Umnutzung zahlreicher Industriebrachen in der Schweiz projektiert - u.a. das Steinfelsareal, das Toni- und das Escher-Wyss-Areal. Das Büro hat rund 30 Bauten realisiert und Forschungen zur Urbanität, Öffentlichkeit und zum Wohnungsbau verfasst. Aktuelle Projekte hat das Büro in Zürich, Deutschland, Italien und Griechenland.
Nach der Bürgerbefragung bleibt in Reininghaus alles beim Alten, was die Frage einschließt: Welche Chance bietet die große Brache für die Stadtentwicklung von Graz?
Der schweizerische Architekt und Universitätsprofessor Ernst Hubeli hat am 24. Juli 2012 dem ‚Standard’ ein kurzes Interview zu dieser Frage gegeben (siehe LINK unten), das im Folgenden mit einer fachlichen Diskussion vertieft wird. Hubeli war Leiter des Instituts für Städtebau an der TU Graz und hat ‚Asset one’, die Entwicklungsgesellschaft von Reininghaus, mehrere Jahre beraten.
Die Bürger haben mit großer Mehrheit den Kauf der Reininghausgründe abgelehnt, was für viele keine Überraschung war.
Hubeli: Auch für mich nicht. Die Befragung war ja eine Zumutung, da eine Katze im Sack zum Kauf stand, die sich nicht nur als Wolf erweisen könnte, sondern als ein zu teures Areal. Auch die Hintergründe blieben im Dunkel. Geht es um die Rettung der verschuldeten Besitzer oder um öffentliche Interessen der Stadt? Vielmehr hätte die Frage interessiert: Welche Chance bietet die „größte Brache in Europa“ für die Stadtentwicklung von Graz?
Wer hätte die Frage aufwerfen sollen?
Hubeli: Vor allem die lokalen Printmedien haben es verpasst, zu informieren und aufzuklären. Vermutlich waren auch sie überfordert. Die Printmedien sind gegenüber den Netzmedien in ganz Europa schon länger im freien Fall – die steirische Presse scheint schon unten angekommen zu sein.
Es geht das Gerücht um, dass die Filetstücke von Reininghaus bereits verkauft sind, sodass eine Stadteilplanung als Ganzes nicht mehr möglich ist?
Hubeli: Nach meinen Informationen nicht in dem Ausmaß, dass eine Stadtentwicklung verunmöglicht würde. Entscheidend ist also die Frage: Gelingt es der Stadt, die weitere Zerstückelung des Gesamtareals zu verhindern, damit Reininghaus als Ganzes entwickelt werden kann? Gelingt es nicht, so muss man davon ausgehen, dass ein trostloses Wohnghetto entsteht.
Um das zu verhindern, gibt es zwei Möglichkeiten: Erstens wissen die Besitzer selbst, dass sie im eigenen Interesse ein städtebauliches Gesamtkonzept entwickeln, damit nicht 0815, sondern Hochwertiges entstehen kann. Zweitens kann die Stadt davon ausgehen, dass ein Areal ohne Rechtssicherheit wenig wert ist. Anders gesagt: Die Stadt kann verlangen, dass zuerst ein Gesamtkonzept für die Entwicklung von Reininghaus vorliegen muss. Und zwar nicht ein simpler Bebauungsplan, sondern eben ein Konzept, das die schrittweise Entwicklung wie den Planungsprozess einschließt.
Es stellen sich nun Fragen zu Reininghaus, welche bisher noch nicht diskutiert wurden, weder in den Printmedien noch politisch: Was könnte das Gesamtkonzept sein? Wie könnte es entwickelt werden? Und welche Chancen sind damit für Reininghaus und Graz verbunden? Da stellt sich ja zuerst die Frage, ob man ganze Stadteile noch wie früher planen kann oder ob man überhaupt noch so große Areale planen kann?
Hubeli: Um die Fragen zu beantworten, scheint mir eine Klärung nötig, was heute Stadt, was Urbanität bedeutet. Zum einen befinden wir uns im Übergang von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Bildungsangebote und Wissensproduktion sind die wichtigsten Standortfaktoren für die Städte geworden, wichtiger als Kultur. Zum anderen bedeuten neue Lebensgewohnheiten, die Telekommunikation, ökologische Probleme und die Dynamik globaler Märkte neue Herausforderungen für alle Städte.
Was sind die Folgen für die Stadtplanung?
Hubeli: Man kann nicht mehr einfach festlegen, da wird gewohnt, dort gearbeitet und dort muss man sich erholen. Mit der Telekommunikation sind viele Tätigkeiten ortsunabhängig und delokalisierbar. Wer wo was tut, ist nur noch teilweise planbar, so wie es mehr Freiheiten für die Einzelnen gibt. Im Fachjargon sprechen wir deshalb von einem postfunktionalen Städtebau.
Haben das Handy und das Internet die Stadt verändert?
Hubeli: Mit dem Internet und Handy verdoppelt sich die Stadt: sie existiert physisch und virtuell. Mit dem Navigieren wird jede Stadt größer und zugleich kleiner, weil man schnell einen Überblick gewinnt und ihn auf Bildschirmgröße reduzieren kann. Neu ist auch, dass übers Netz die Stadt und ihre Ereignisse nicht nur navigiert, sondern auch generiert werden.
Die Folge ist, dass die Städte sich anders entwickeln und gebraucht werden.
Hubeli: Wie eine Stadt, ihre öffentlichen Räume, ihre Häuser und Areale gebraucht werden, ist einer viel höheren Ungewissheit und Dynamik ausgesetzt als früher. Umso mehr gilt umgekehrt, dass beliebte Orte und Stadtteile - sogenannte Dauerbrenner – sich dieser Dynamik entziehen können und erhalten werden.
Städte stehen in einer harten Konkurrenz. Wie kann sich eine Stadt am besten an diese Erneuerungen anpassen, um sich Standortvorteile zu verschaffen?
Hubeli: Sie muss viel mehr Spielräume einplanen - auch Leerstellen, weiße Flecken im Stadtplan, damit sich die Quartiere der erhöhten Dynamik und den neuen Bedürfnissen besser anpassen können. Es braucht vermehrt „Orte, wo (noch) nichts geschieht“, wie Peter Handke sagt.
Der Umbau einer Stadt geht nicht von heute auf morgen.
Hubeli: Städte können sich nur langsam anpassen. Sie befinden sich immer in Übergangsphasen - das Neue ist im Alten noch nicht sichtbar. Wenn aber eine Stadt den neuen Wirklichkeiten zu lange hinterherhinkt, verpasst sie den Anschluss.
Ob eine Stadt einem gefällt, hat auch subjektive und persönliche Motive.
Hubeli: In der Tat. Eine Stadt wird vor allem emotional erfahren und beurteilt wie Stadtforschungen der letzten Jahre zeigen. Das hat auch mit den neuen Medien zu tun. Wenn eine Stadt individuell übers Handy oder Internet navigiert wird, entsteht ein persönlicher Dialog mit der Stadt - mit Bildern, Informationen und Versprechen. So haben alle einen emotionalen Stadtplan im Kopf, eine Art urbanes Genussextrakt, das sich natürlich immer neu mischt. Insofern ist heute die Stadt ein kommunikatives Nervensystem.
Ersetzt Kommunikation die Stadtplanung?
Hubeli: Stadtplanung muss sich in dieses Nervensystem einlinken und interaktiv planen. Das heißt, dass die Planung nicht mit einem Plan beginnt, sondern mit der Diskussion über Wünsche und Ziele, über Defizite und Möglichkeiten einer Stadt, was die Frage einschließt, welchen Beitrag einzelne Projekte für die Stadtentwicklung leisten können. Das ist heute der wichtigste Job für die Stadtregierung und ihre Behörden. Die herkömmliche Planung, die nur den gesetzlichen Rahmen definiert oder alles von oben festlegt, ist nicht bloß veraltet – sie funktioniert nicht und schadet der Stadt.
Dennoch braucht es Pläne.
Hubeli: Pläne sollen als Diskussionsstoff und nicht als etwas Fertiges kommuniziert werden. Pläne sind sehr fehleranfällig. In Brasilia zum Beispiel wurde nicht der großzügig geplante ‚Corso’, sondern seine Anlieferungsstraße zum wirklichen Corso. Heute werden in Europa unzählige ‚Piazzas’ gebaut und niemand kommt. Und in den neuen ‚Boulevards’, die alten Glamour versprechen, wartet man vergeblich auf den Kaiser.
Das Paradox, dass Stadträume anders gebraucht werden als geplant, ist nicht neu. Die Passagen in Paris des 19. Jahrhunderts waren als Erweiterung der Ladenzone geplant und wurden zum beliebten öffentlichen Raum, wo täglich Feste stattfanden und politisch debattiert wurde.
Hubeli: Eine Stadt kann man mit einem Buch vergleichen. Die Leser produzieren Texte im Text, Bilder im Bild, Spiele im Spiel. Genauso muss man die Stadt verstehen: Sie wird nicht nur oft anders gedeutet als geplant, sondern ständig neu interpretiert und neu gebraucht. Sie ist ein unfertiges Projekt und ein ewiges Gedankenexperiment. Und wie bei einem Buch ist das Verhältnis zwischen Autor und Leser unberechenbar. Ein Plan, der alles kontrollieren und bevormunden will, kann nicht funktionieren. Er muss ‚weich’ sein, was in der Stadt ja auch für Tatsachen wie der Stein gilt, der früher mehr Stein war, wie Wittgenstein sagt.
Die Städte stehen vermehrt unter einem Konkurrenzdruck, was auch die Machtverhältnisse ins Wanken bringt. Zum einen müssen unterschiedliche Interessen von Investoren, der Politik und der Bürger ausbalanciert werden; zum anderen braucht es ein Stadtentwicklungskonzept, das diesen Interessen oft widerspricht, weil es langfristig und über Wahlperioden hinaus angelegt sein muss.
Hubeli: Mit der wachsenden Konkurrenz unter den Städten haben sich die Machtverhältnisse verschoben: Was nützt Macht und Geld, wenn die Bürger ihre Stadt verlassen? In Immobilienkreisen herrscht die begründete Angst vor Lageentwertungen, Leerbeständen und von Abwanderungen, was schneller passiert, als man denkt, wenn sich der Ruf einer Stadt verschlechtert.
Die Alltagserfahrungen der Bürger prägen den Ruf einer Stadt. Er ist unbestechlich und zugleich relevanter geworden, da die Bereitschaft, von einer Stadt in eine andere umzuziehen, stark zugenommen hat. Zudem findet in ganze Europa eine evidente Stadtrückwanderung statt, die auch die Frage aufwirft, welche Stadt am besten gefällt.
Was wollen die Immobilienbesitzer, was will die Regierung, welche öffentlichen Interessen stehen privaten gegenüber, welche realen Entwicklungschancen gibt es? Es dauert lange, um solche Fragen zu beantworten.
Hubeli: Es dauert noch länger, wenn eine Stadt falsch plant, weil man immer wieder von vorne beginnt, um die Fehler zu korrigieren. Und der größte Fehler ist, die erwähnten Herausforderungen zu ignorieren und gegen die Interessen der Bürger zu planen.
Also eine ausgebaute Bürgerbeteiligung?
Hubeli: Sie ist eine Voraussetzung, aber kein Allheilmittel. Und die alten und naiven Formen der Beteiligung bringen nichts. Wir Schweizer sind bekanntlich mit allen demokratischen Wassern gewaschen – inklusive Tricks und Fakes – und wissen, dass Bürgerbeteiligung nur Sinn macht, wenn im Voraus geklärt ist, wie das Entscheidungsverfahren definiert ist, was die Frage einschließt, inwieweit Eigentumsverhältnisse antastbar sind oder nicht. Ein bloßes Abtasten der Volksmeinung, um dann anders zu entscheiden, bringt eine Stadt und ihre Regierung nachhaltig in Verruf.
Umgekehrt stoßen demokratische Verfahren gerade in der Stadtplanung an ihre eigenen Grenzen. Zum einen, weil oft egoistisch entschieden wird - wie etwa, wenn die neue Straßenbahn nicht am meinem Haus vorbei fährt, bin ich dagegen. Und es gibt natürlich auch Fragen, die viele überfordern und eine professionelle Sicht verlangen.
Bürgerbeteiligungen sind oft frustrierend. Entweder kann man nur mitsprechen, aber nicht mitentscheiden. Sie haben es angedeutet – es gibt auch andere Formen.
Hubeli: In einigen europäischen Städten wird bereits eine andere Form der Bürgerbeteiligung praktiziert, die im Kern ein Städtebau von unten ist. Gruppen, Szenen und urbane Milieus reagieren nicht mehr auf Projekte der Stadt, sondern agieren selbst. Sie organisieren Öffentlichkeit und Ereignisse – temporär, ad hoc oder längerfristig, was die kommunikativen Netze erleichtern. So kann man auch erfahren, dass anderes möglich ist als die immer gleichen Immobiliengestelle.
In Berlin und Barcelona sind solche selbstorganisierende Formen wichtiger geworden als die offizielle Stadtplanung. Viele Fachleute sagen, dass diese Art der Stadtaneignung heute sogar die Voraussetzung ist, dass die Bewohner sich mit ihrer Stadt identifizieren und eine emotionale Bindung entwickeln. Jedenfalls sind solche Gruppen und Szenen urbane Generatoren und ein Gewinn für jede Stadt und insofern auch wichtige Partner der Stadtplanung.
Muss man solche Aktivitäten unterstützen?
Hubeli: Nein. Urbaniten reagieren allergisch auf Bevormundung. Sie brauchen nur Frei- und Spielräume, dann entsteht vieles von selbst, wie zahlreiche Beispiele - vor allem bei Umnutzungen von Industriebrachen - in Europa belegen. Dazu passt auch eine Schlüsselerkenntnis der letzten Jahrzehnte: Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass urbanes Leben nicht geschieht, wo es geplant wird und geschieht, wo es nicht geplant wurde. Das heißt nicht, dass es keine Stadtplanung mehr braucht - im Gegenteil - sie muss aber umdenken, um noch wirksam zu sein.
Architektursensationen können aber auch eine Stadt aufwerten. Zum Beispiel Bilbao mit dem Guggenheim-Museum.
Hubeli: Das war einmal, 1997. An diesen Voodoo-Zauber glaubt heute selbst sein Erfinder nicht mehr. Als Herr Krens, der Guggenheim-Chef, diesen medialen Oberflächenknaller ins Internet gesetzt hatte, sprach man vom „Bilbao-Effekt“ und viele Plagiate entstanden. Krens hat aber erkannt, dass sich der Effekt nicht wiederholen lässt. Von seinen 32 Museumsprojekten à la Bilbao hat er 30 wie heiße Kartoffeln fallen lassen und beim zweiten in Las Vegas einen Baustopp befohlen.
Nach dem Bilbao-Effekt sprechen wir heute vom Wolfsburger-Effekt: Die unbeachtete Stadt hat Milliarden in aufsehenerregende Allerweltarchitektur investiert, ohne dass es jemand gemerkt hat. Mit anderen Worten: Die vermeintlichen Wahrzeichen haben heute die Bedeutung von Bierdeckelentwürfen für eine Wurlitzer Orgel der Form.
Die Tourismusförderung glaubt immer noch an die so genannte Aufmerksamkeitsökonomie, die mit außergewöhnlichen Bauwerken und ihrer medialen Verbreitung erreicht werden kann. Vor allem kleinere Städte, die wenig beachtet werden, sehen darin ein Mittel für eine Aufwertung.
Hubeli: ein teurer Irrtum. Provinzielles verschwindet weder mit dem höchsten Hochhaus noch mit architektonischen Aufdringlichkeiten. Am Bildschirm und für den Touristen kann ja alles größer und bedeutender erscheinen, als es wirklich ist. Inzwischen wird das durchschaut. Selbst Stadtmarketingprofis glauben heute nicht mehr an medial gezüchtete Stadtprofile. Das heißt: Entweder ist der Alltag in einer Stadt eine Sensation oder es gibt keine.
Unbefangene Stadtforscher wie etwa Walter Siebel kamen zu einer ähnlichen Erkenntnis: Eine Stadtwirtschaft, die auf Events und Tourismus fundamental angewiesen ist, macht sich abhängig von unberechenbaren Zyklen, sodass sie von einer Krise in die andere schlittert.
Das gilt auch für Graz?
Hubeli: Insofern als Graz die Übungen mit dem global Architecture-Business und angekündigter Weltkultur hinter sich hat. Wer nicht blauäugig ist, zieht die Bilanz so: außer Spesen nichts gewesen. Die Stadt Graz macht sich viel attraktiver, wenn sie sich zu dem bekennt, was sie ist: eine Provinzstadt ohne Minderwertigkeitskomplex. So kann sie jene Vorteile ausreizen, um welche Großstädte sie beneiden. Spielräume für Unbekanntes, Experimentelles, Nischen für Kunst, Musik und Wissenschaften. Kultur ohne Pomp aber mit Qualität und Kompetenz.
Das gibt es ja teilweise schon in Graz. Gäbe es noch Anderes?
Hubeli: Graz ist ja auch eine Bildungsstadt, wo die Universitäten und Hochschulen mit ihrem Wissen und Können sich viel mehr am Alltagsleben und an der Stadtentwicklung beteiligen könnten. Ich habe das an der TU Graz teilweise getan und hätte das noch ausgeprägter getan, wenn der damalige Rektor (Hans Sünkel, Anm. d. Red.) die Zeitzeichen der postkaiserlichen Wissensgesellschaft besser erkannt hätte: Eine Universität ist kein Bildungstempel mehr, sondern eine Stadt in der Stadt, die sich dem öffentlichen Leben öffnet und an ihm teilnimmt.
Wie anfangs erwähnt: Reininghaus steht an. Sie waren einige Jahre an der Planung mit ‚Asset one‘ beteiligt. Das Areal ist so groß wie die Altstadt, aber von ihr abgeschnitten. Es gilt als schwieriger Fall.
Hubeli: Der gerade deshalb eine große Chance für Graz ist. Das setzt allerdings eine doppelte Einsicht voraus: Erstens fehlen Graz Großinvestoren und Instanzen für Großprojekte (was zu einem Vorteil werden kann, wenn man ihn nutzt); zweitens können in Reininghaus die üblichen Planungsverfahren nicht greifen.
Die Chance besteht in den großen Potenzialen von Industriebrachen. Es ist wenig vorbestimmt, was viel ermöglicht und lebenspraktischer ist als durchgeplante und durchdesignte Zonen. Graz wäre nicht die erste Stadt, die diese Potenziale wahrnimmt. Graz wäre wohl eher die letzte Stadt, welche diese Chance verpasst.
Bis heute hat man den Eindruck, dass mit Reininghaus eher ein politisches Problem für Graz entsteht als eine Chance.
Hubeli: Die bisherigen Schnellschussprojekte bestätigen diesen Eindruck, die keinen Stadtteil, sondern ein Wohnghetto mit Alibi-Kultur vorsehen. Exemplarisch dafür waren die Allerwelt-Architekturbilder im ‚Anzeiger’, der den Kauf von Reininghaus schmackhaft machen wollte. Die suggestive Werbung hat offenbar das Gegenteil bewirkt. Dazu gehört, dass der Schnellschuss offenbar einen Denkstopp geopfert hat, nach dem der Architekt noch vor kurzem einen Baustopp für Reininghaus gefordert hatte, um Zeit zum Nachdenken zu finden. Doch solche Skizzen sind weniger fatal als das Maklerszenario: Reininghaus wird in einzelne Grundstücke zerstückelt, um sie möglichst rasch zu verhökern. Damit würde die Chance vertan, Reininghaus als Stadtteil zu entwickeln.
Die Stadt Graz könnte mit ihren politischen und planerischen Mitteln die Chance wahrnehmen. Wie könnte sich in diesem Fall diese Brache zu einem Stadtteil entwickeln?
Hubeli: Als erstes: keine Pläne, sondern ein Diskurs über mögliche Szenarien, welche die anfangs erwähnten Herausforderungen thematisieren.
An welche Szenarien denken Sie?
Hubeli: Das erste Szenario sollte sich um ein Defizit drehen: Graz hat einen starken Nachholbedarf an Wohnungen, die den demografischen und gesellschaftlichen Wandel der letzten 30 Jahre nachvollziehen. Fast alle Wohnungen sind noch auf die klassische Kleinfamilie zugeschnitten, die in der Realität längst eine Minderheit ist. Und selbst die Kleinfamilie hat heute ganz andere Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten als früher.
Es braucht mehr temporäre, generationenübergreifende und hotelähnliche Wohnformen. Solche werden in vielen Städten in Europa zurzeit realisiert. Sie bieten auch volkswirtschaftliche Vorteile. Unter anderem können sie die teuren und deprimierenden Altersghettos weitgehend ersetzen.
Dieser Nachholbedarf überlagert eine weitere Chance, die bereits ein Realszenario ist: die Stadtrückwanderung. Sie kann einen großen Gewinn bedeuten. Das setzt aber voraus, dass die Rückwanderer mit attraktiven Angeboten empfangen werden.
Ist die Rückwanderung aus der Agglomeration ein anhaltender Trend?
Hubeli: Ja, aus verschiedenen Gründen. Teilweise wollen die Agglomeriten, teilweise müssen sie zurück in die Stadt. Die steirische Zersiedlung hat ein perspektivloses Ausmaß angenommen - sie wird schlicht unbezahlbar, sowohl für den Staat als auch für die Pendler.
Zum anderen ist das Einfamilienhaus immer weniger das Ideal, so wie immer weniger Frauen ihr Glück in einem grünen Mutter-Kind-Ghetto finden. Die UNESCO geht davon aus, dass in naher Zukunft nicht mehr 50%, sondern 80% der Menschen in den Städten leben werden.
In Graz hat man den Eindruck, dass nur alte Wohnungen angeboten werden und selbst die neuen sind wie die alten projektiert.
Hubeli: Das kann für Graz fatal werden. Eine Stadt muss im Gegensatz zum Dorf eine Vielfalt an Wohn- und Lebensformen ermöglichen. Das ist auch die Kernqualität europäischer Urbanität: Jeder Lebensentwurf soll eine Realisierungschance haben. In diesem Zusammenhang besteht das zweite Szenario: eine städtische Lebenswelt mit Zukunft.
Die Leute erwarten von der Stadt mehr Lebensqualität als auf dem Land?
Hubeli: Die Alten kommen in die Stadt, weil sie eine bessere Versorgung und insgesamt niedrigere Lebenskosten haben. Bei dem wachsenden Altenanteil werden diese Aspekte immer relevanter. Die Jüngeren kommen, weil den meisten das Einfamilienhaus als Auslaufmodell erscheint. Sie suchen nach anderen Wohn- und Lebensformen, die sie eher in der Stadt finden. Das belegt die Tatsache, dass der Anteil ‚lokaler Urbaniten’ stark ansteigt, die mehr Zeit in der Stadt als in der Wohnung verbringen wollen. Sie beleben die Stadt, produzieren Öffentlichkeit und Arbeitsplätze - sie sind die Keimzellen von Urbanität, die Pantoffelhelden bekanntlich nicht zum Blühen bringt.
Wie gesagt, die Alten und Jungen kommen nur, wenn ihnen eine Stadt auch bietet, was sie sich wünschen. Es gibt ja immer mehr Städte, wo die Uhren anders ticken als alte Mühlen.
Urbanisierung wird heute in Europa mit einer ‚Verdichung nach innen’ verbunden. Die Städte sollen dichter bebaut werden, aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen. Dieses Szenario ist wohl auch ein Thema für Reininghaus. Dabei stellt sich die Frage, ob hohe Dichte nicht die Lebensqualität verschlechtert. Die meisten möchten wohl eher eine grüne als eine steinerne Stadt.
Hubeli: Die Attraktion von Dichte ist das nahe Nebeneinander von allem. Wir sprechen von einer ‚vertikalen Stadt’, was nicht Hochhäuser voraussetzt, aber eine Dichte, die erlaubt, von der Wohnung unmittelbar in das Stadtleben einzutauchen. Es geht also nicht bloß um bauliche Dichte, sondern um viele Optionen, Aktivitäten und Dienstleistungen an einem Ort.
Und wie Sie angedeutet haben: Dichte als Lebensqualität setzt voraus, dass sie mit dem Gegenteil - mit Undichte - koexistiert. New York ohne den Central Park wäre eine öde Steinwüste. Hohe Dichte braucht leere Orte von kontemplativer Nutzlosigkeit, wo tatsächlich nichts geschieht, wo Nichtstun gerade nicht unter dem Blickwinkel vom Nichtstun gesehen wird. Und hohe Dichte darf nicht mit dem Nachteil von Lärm erkauft werden. Jede Wohnung braucht eine Stadtseite und eine ruhige Seite zu einem Hof, Garten oder Park. Neuere Beispiele in Europa belegen, dass dieses Grundkonzept auch realisierbar ist, das Kurt Tucholsky sich vor 100 Jahren schon gewünscht hat: „Vorne den Ku‘damm, hinten die Nordsee.“
Verdichten und Nutzungsvielfalt gehören zusammen?
Hubeli: Unbedingt. Das eine ohne das andere ergibt keinen Sinn. Das gilt im Besonderen für Reininghaus. Der gröbste Fehler wäre, wenn das Areal mit Wohnbauten vollgestopft würde. Es entstünde eine Stadt ohne Stadt. Und wenn solche Monofunktionalität im Namen von energiesparenden Hochhäusern angepriesen wird, dann handelt es sich um einen grundlegenden Denkfehler: Der größte Energieverschleiß entsteht durch lange Wege und entsprechende Fehlplanungen, die ein mühsames Alltagsleben erzwingen.
Graz hat sich in einem Wettbewerb um 'Smart City' durchgesetzt und EU-Mittel erhalten, um eine vorbildliche Stadtentwicklung zu realisieren.
Hubeli: Soviel ich weiß, sieht der Stadtplaner und Mitverfasser von ‚Smart City’, Heinz Schöttli, im etwas abgedroschenen Begriff Nachhaltigkeit auch mehr als ein kurzsichtiges Energiesparen, das ja schnell zum Gegenteil werden kann, wenn man nicht Gesamtbilanzen berücksichtigt. Dazu gehören Verdichtung, Nutzungsvielfalt, kurze Wege, ein angenehmes und anregendes Alltagsleben usw. Und solches muss auch für die Planung von Reininghaus die Grundlage sein, damit nicht ein ödes, monothematisches Wohnghetto entsteht.
Verdichtungen und Nutzungsvielfalt reduzieren auch den Verkehr.
Hubeli: Ja, aber nicht automatisch. Es braucht Anpassungen. Eine solche wurde in Graz bei der Planung der Annenstraße leider verpasst. In ganz Europa hat man sehr gute Erfahrungen mit dem Mischverkehr gemacht: 30 oder 20km/h (reduziert den Lärm um die Hälfte), keine Fahrbahnen (öffentlicher und Privatverkehr sind gemischt), keine Fußgängerstreifen, keine Signalisierung - die Straßen sind platzartig gestaltet und organisiert, alle Läden und Restaurants können Tische hinausstellen. Viele solcher Projekte werden zurzeit realisiert, auch von unserem Büro: die Güterstraße in Basel, 1,5 Kilometer lang.
Gegen den zunehmenden Freizeitverkehr ist man hingegen machtlos?
Hubeli: Er macht zurzeit mehr als die Hälfte am gesamten Verkehrsvolumen aus. Insofern ist ein tolles Freizeitangebot innerhalb der Stadt relevant. Früher oder später kann die Kostenwahrheit vom Verkehr – inklusive Folgekosten vom Klimawandel und Subventionen – politisch nicht mehr verdrängt werden, was das Alltagsleben über Bio-und Elektrovehikel hinaus verändern wird. Die Gegensatzkonstruktion vom nahen Wohn- und fernen Urlaubsort wird sich aufweichen, sodass man schon heute Sandstrände in die Quartiere einplanen kann.
Wie könnten diese verschiedenen Erkenntnisse und Ideen auf Reininghaus übertragen werden? Was wäre der erste Schritt?
Hubeli: Er besteht in einer Einladungspolitik. Die möglichen Szenarien sollen über Bürgerveranstaltungen hinaus in den Medien und an den Hochschulen diskutiert werden - als eine Kontroverse über Ziele, Wünsche und Interessen von Gruppen, Machern und Kooperationen. Selbst wenn solche Diskussionen schwierig sind - sie sind unverzichtbar. Denn ein Plan von oben - wie etwa ein Masterplan - ist für ein 55 Hektar-Areal unrealistisch und selbstzerstörerisch, weil er der Aufgabe weder angemessen ist, noch zielführend sein kann. Die Chance würde vergeudet, neben der Altstadt einen Stadtteil zu entwickeln, der einen ähnlichen Stellenwert für Graz erreicht, aber nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart und Zukunft von Graz zum Thema hat.
Wieso sind die herkömmlichen Bebauungs- und Masterpläne veraltet?
Hubeli: Weil sie Endzustände festlegen, die wirklichkeitsfremd sind. Dies gilt im Besonderen für Reininghaus, das schlicht zu groß ist für einen Masterplan.
Der letzte Fall, der noch auf einem großen Masterplan basierte, ist die Hafencity in Hamburg, was zu einem Desaster wurde. Die City lebt nicht, weil alles viel zu starr geplant ist, weil keine wirkliche Mischnutzung zustande kommt, weil die Erdgeschoße falsch konzipiert sind, weil die traditionelle Straßenbebauung vollkommen veraltet ist, da sie weder die Nutzungsdynamik noch heutige Formen von Öffentlichkeit auffangen kann.
Das Resultat sind hohe Fluktuationen und Leerbestände. Viele Wohnungen können nicht vermietet oder verkauft werden. Das Ganze hat sich zu einem Immoblien-Gau verschärft, weil nun auch Großinvestoren und Konsortien von internationalen Banken ausgestiegen sind, was das Zentrum der Hafencity - das Überseequartier Süd - in apokalyptischer Weise veranschaulicht: Von den großen Plänen ist nur eine riesige Baugrube geblieben und weiter nichts.
Eine Stadtentwicklung braucht Spielräume.
Hubeli: Es gibt zwar kein Grundrezept. Aber am besten ist es, wenn Stadteile heute wie eine antizipierende Spielanlage verstanden und geplant werden. Mit Spielräumen, Leerstellen, mit temporären Szenarien, Zwischennutzungen usw. Nur so kann sich ein Stadtteil den Bedürfnissen und Veränderungen anpassen. Und nur so kann ein vitales Quartier entstehen, das nicht monothematisch und monosozial ist. Geplante Endzustände werden früher oder später zum Zwang, der stadtfeindlich oder gar stadtzerstörerisch ist.
Eine Spielanlage anstelle eines Masterplans - auch für Reininghaus?
Hubeli: Als erste Karte soll eine sanfte Transformation mit starker Wirkung ausgespielt werden - eine Initiale, die keine Ankernutzung definiert, sondern das Niemandsland thematisiert, die vorhandene Leere. Das hat viele Vorteile, weil Freiräume am besten sind, um sie als Test- und Entwicklungsgebiet zu benützen, um Erfahrungen zu sammeln und Potenziale auszuschöpfen. Ein solches Spielfeld ist eine Initialzündung und zugleich ein Geschenk für die Grazer, die ihr Selbstverständnis überprüfen können, ob in ihrer Stadt tatsächlich „die Uhren anders ticken“. Ich bin nicht nur überzeugt, dass solche Initialen in Graz zustande kommen, sondern dass sie auch die Keimzellen für eine attraktive Stadtentwicklung werden, was eben smarte Holzhäuser nicht leisten können, die gerade in Reininghaus (Reininghaus-Süd, Anmerk. d.R.) geplant werden.
Ein Freiraum allein genügt aber nicht.
Hubeli: Zu Reininghaus gehören die vorhandenen Industriebauten, die temporär oder längerfristig benützt werden können. Sie dienen dazu, mögliche Nutzungen zu erproben, was einen Planungsprozess ermöglicht, der offen und intelligent ist, weil er Impulse und Erkenntnisse fortwährend integrieren kann. Ein Masterplan hingegen kann nur zeigen, was ihm sich nicht fügt. Zudem haben wir die Erfahrung gemacht, dass Altbauten für Zwischennutzungen und Umnutzungen ein unersetzliches Kapital sind - sie verhindern eine Tabula rasa und ermöglichen dennoch Neues. Der Abbruch solcher Industriemonumente ist kontraproduktiv und dumm.
Der Freiraum wäre eine Art Park?
Hubeli: Ein Park der unbekannten Möglichkeiten. Er ermöglicht punktuelle Interventionen mit verschiedenen Akteuren und Kooperationspartnern, die allerdings nicht irgend etwas produzieren, sondern die erwähnten und weitere - eben noch unbekannte - Szenarien thematisieren. Ein solcher Park könnte an die Tradition der französischen ‚Follies’ anknüpfen, versetzt in die heutige Zeit, in der über Netze und Kommunikation Keimzellen von Urbanität entstehen.
Wer bezahlt das?
Hubeli: Solche Transformationen sind keine caritative Angelegenheit. Sie machen aus Reininghaus - aus einer Null-Adresse - eine Adresse, wo man hingeht. Es geht also um eine Aufwertung der Brache, die aber nicht durch schnelles Bauen und Steuergelder entsteht - etwa durch eine neue Straßenbahn. Die Aufwertung geschieht durch Aktivitäten, Öffentlichkeit und Ereignisse, was eine Voraussetzung ist, damit sich der Stadtteil mit einem realen Hintergrund und Alltag weiterentwickeln kann. Dieses Konzept, das praktisch nichts kostet, passt in das Projekt ‚Smart City’, wenn man es so versteht, dass mit dem kleinst möglichen Eingriff die größtmögliche Wirkung erzielt wird - städtebaulich, lebenspraktisch und für die Zukunft von Graz.
Danke für das Gespräch!
Das Gespräche mit Ernst Hubeli wurde von Angela Robert und Nicola Früh, zwei deutschen Studentinnen, die sich mit Graz-Reininghaus beschäftigen, bei einem Workshop im Stadtplanungsamt Graz geführt und wurde GAT freundlicherweise von Ernst Hubeli zur Veröffentlichung überlassen.